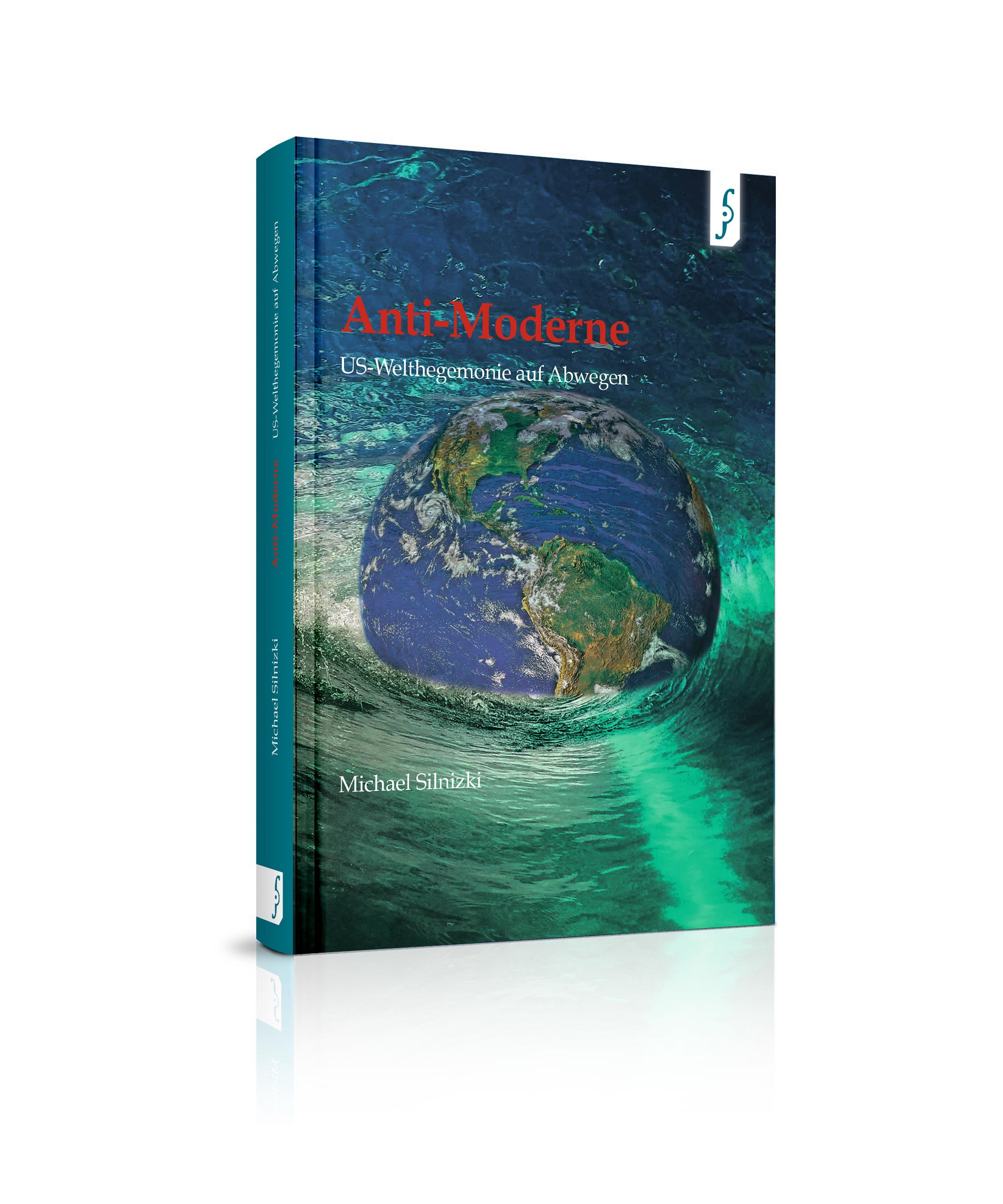Zur Frage nach Universalität und Humanität der westlichen Werte
Übersicht
1. Verfassungsideologie und der postsowjetische Raum
2. Menschenrechtsideologie im Lichte der US-Innenpolitik
3. Die westliche universale Idee im Lichte der säkularisierten Eschatologie
Anmerkungen
1. Verfassungsideologie und der postsowjetische Raum
1866 sagte Bismarck beiläufig im Abgeordnetenhaus: „Mir sind die auswärtigen Dinge an sich Zweck und stehen mir höher als die übrigen.“1 Bismarcks Äußerung kommentiert Hans Rothfels mit den Worten: „Die absurde und letzten Endes gotteslästerliche Ansicht, Außenpolitik sei >Zweck an sich<, hat Bismarck gewiss nicht aufstellen wollen.“
Was wollte Bismarck dann? War die Außen- bzw. Weltpolitik2 nicht immer schon Deutschlands Schicksalsfrage? Und wie sah das bei den anderen europäischen Großmächten aus? „In den angelsächsischen Ländern spricht alte Überlieferung für einen Primat der Innenpolitik, wenn nicht dem Wort, so doch der Sache nach“3, wohingegen in Russland die Geopolitik die Innenpolitik in den Schatten stellt. Russlands Geopolitik war immer auf Raumbeherrschung und Raumsicherung angelegt und bleibt heute ebenfalls primär auf die Verteidigung und Sicherung des nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums übrig gebliebenen Machtraumes ausgerichtet, was zu Lasten der neuzeitlichen Verfassungsentwicklung geht.
Geht man von der von Hermann Oncken im Anschluss an Ranke aufgestellte Grundannahme aus, dass nämlich „die internationale Machtordnung … als bedeutsames >Regulativ< der Verfassungsgestaltung eines Staates aufzufassen sei“4, so trifft diese auf die westeuropäische Verfassungsgeschichte bezogene These Russlands Verfassungsentwicklung in keinerlei Weise.
Wenn man die Verfassungsentwicklung als Funktion der Geopolitik dahingehend deutet, dass der Westen den außerwestlichen Kultur- und Machträumen eine liberale Verfassung oktroyieren zu können glaubt, dann ist man auf dem Holzweg. Außerhalb des Westens ist eine Entwicklung zu einer liberalen Verfassungsordnung nie vollzogen worden. Die sog. „liberale Demokratie“ gehört zu jenem einzigartigen Phänomen der Weltgeschichte, das nur der Okzident hervorgebracht hat.
Eine ganz andere, rechts- und verfassungshistorische Entwicklung vollzog Russland, dessen zentral gesteuerte Raumbeherrschung die Entwicklung zu einer „liberalen Demokratie“ verunmöglichte, sodass die Delegitimierung der traditionellen russischen Herrschaftsauffassung selbst nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches 1917 nicht stattgefunden hat. Der Sowjetstaat hat die autokratische Herrschaftstradition des Russischen Reiches nicht zerstört, sondern ganz im Gegenteil bis auf die Spitze getrieben und letztlich totalisiert.
Mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums traten an Stelle der totalitären die tradierten autokratischen Herrschaftsstrukturen. Und lassen wir uns nicht täuschen: Die Revitalisierung der tradierten Herrschaftsauffassung fing nicht erst mit Putins Regentschaft an, sondern geht bereits auf Jelzins Präsidentschaft zurück. Eine „liberale Demokratie“ hatte im Russland der 1990er-Jahre wegen der fehlenden institutionellen Strukturen und mentalen Voraussetzungen gar keine Chance auf Verwirklichung. Die Funktionsfähigkeit eines liberalen Verfassungsstaates setzt eine jahrhundertelange Entwicklung der westlichen Rechtskultur voraus, die es nicht nur in Russland, sondern auch in den anderen, außereuropäischen bzw. außerwestlichen Kulturen so nie gegeben hat.
Hinzu kommt ein verfassungshistorisches Problem. Als eine zentral gesteuerte Raummacht war Russland nie ein Nationalstaat, der eine gewisse kulturelle und ethnische Homogenität zur Voraussetzung hat. Der westeuropäische Nationalstaat war aber „in aller Regel auch ein moderner Verfassungs- und Rechtsstaat“5. Das liegt nicht nur, aber auch am imperialen Charakter der russischen Geschichte der vergangenen dreihundert Jahre. „Das Selbstbestimmungsrecht der Völker“ hat zwar der Gründer des Sowjetstaates Lenin – ebenso wie Woodrow Wilson – proklamiert und zur völkerrechtlichen Maxime erhoben. Es trug aber allein einen deklaratorischen Charakter, ganz davon abgesehen, dass die Befolgung des Selbstbestimmungsprinzips – historisch gesehen – oft „desaströse Folgen gezeitigt (hat), die seine Präzisierung und eine pragmatische, kluge Einschränkung gebieten“6.
Eine solche „kluge Einschränkung“ benötigten aber das imperiale Russland und das totalitäre Sowjetsystem gar nicht, weil sie alle Völker und Völkerschaften absorbierten und kraft einer autokratischen bzw. totalitären Herrschaftsausübung einen Zwangsfrieden durchgesetzt haben. Der postsowjetische Raum zeigt uns aber heute mit aller Deutlichkeit, dass die Beseitigung des durch eine imperiale Macht gewährleisteten Zwangsfriedens und die Gründung zahlreicher Einzelstaaten allein auf der Grundlage des ethnisch gefärbten Selbstbestimmungsrechts „desaströse Folgen gezeitigt“ haben.
Kein geringerer als Bismarck sah klar und deutlich die Gefahren einer neuzeitlichen Verfassungsentwicklung, die zwischen einer modernen, liberalen Nationsidee und einem anti- modernen, ethnisch gefärbten Nationalismus schwankte. Im Bann dieser Entwicklung befand er sich „im Zwiespalt zwischen einer älteren Ordnungsidee, in der das Nationale noch gebändigt erschien, und dem durch den Nationalliberalismus geprägten Nationalstaat, der das Nationale zugleich beschränkte und entfesselte.“7
Diese Janusköpfigkeit der Neuzeit, welche die zu einem unauflösbaren Knäuel vermischten – gleichzeitig gebändigten und entfesselten – Geister der Moderne und Anti-Moderne freisetzte, war schon in der Revolution von 1848 zu beobachten. Bereits zu dieser Zeit lernten wir – entrüstete sich Werner Konze (ebd.) in Anlehnung an Franz Grillparzer – „Ansätze jenes Weges kennen, der Humanität durch die Nationalität zur Bestialität (Grillparzer) führen sollte, ohne dass wir damals Ausmaß undKonsequenzen auch nur ahnen konnten.“
Mit der Französischen Revolution ausgebrochene Neuzeit war die Geburtsstunde eines modernen, liberalen Verfassungsstaates und zugleich einer Entwicklung, die den fruchtbaren Boden für die kommende Verfassungsideologie als Funktion der Geopolitik bereitete. Sie veränderte radikal sowohl die traditionellen Verfassungsstrukturen als auch die Lebenseinstellung der Menschen, und zwar in dreifacher Weise:
Sie brach erstens mit der religiösen Begründung der von Gottesgnadentum abgeleiteten Herrschaftsverfassung, an deren Stelle Nation als rein säkulare, verfassungskonstituierende und die Machtauübung legitimierende Instanz trat. Die Entthronung der von Gottesgnadentum abgeleiteten Herrschaft brachte allerdings eine radikale Konsequenz mit sich: die Substituierung der Religion durch Nation. „Wenn die Loyalität gegenüber der Nation auch höheren Rang für sich beanspruchte als jede andere Bindung, dann kam der Nation eine gerade transzendentale Qualität zu“.8
Es entstand zweitens eine auf Nation zurückgeführte nationale Identität bzw. das Nationalbewusstsein als Instrument der Massenmobilisierung. Ethnisch gefärbt und machtpolitisch missbraucht, kann ein solches Instrument zum „nationalen Fanatismus“, sprich: zu einem brutalen Nationalismus entarten.
Mit der Französischen Revolution entstand drittens nicht nur Nation als das Legitimationsprinzip des modernen Staates, sondern auch eine verfassungspolitische Legitimationsgrundlage für hegemoniale Expansions- und imperiale Machtpolitik.
Die vom revolutionären Frankreich ausgehende Expansionspolitik, die sich gegen das Ende des 19. Jahrhunderts zum „europäischen Imperialismus“ (1882 – 1914) entwickelte, ging mit Massenmobilisierung über die Radikalisierung des Nationalbewusstseins bis zum brachialen Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus usw. einher.
Im Unterschied zu Frankreich und der westeuropäischen Verfassungsentwicklung, in der das individuelle Bekenntnis zur grande nation die Nation als politische Willensgemeinschaft konstituierte, war in Mittel- und Osteuropa „die Nationszugehörigkeit dem Belieben des Individuums weitgehend entzogen. Sie war durch objektive Faktoren wie blutmäßige Abstammung, Sprache und kulturelle Überlieferung bedingt. Einem voluntaristischen stand mithin ein deterministischer Begriff der Nation gegenüber“ (ebd., 54).
Kurzum: Es fehlte Osteuropa eine Verfassungsentwicklung, die wir heute als einen „Verfassungsliberalismus“ bezeichnen. Der englische Historiker Edward August Freeman (1823 – 1892) drückte sich „abschätzig und einsichtig zugleich“ aus, als er die unterschiedlichen verfassungshistorischen Entwicklungen in Ost und West im Jahr 1879 auf eine prägnante Formel brachte: „The absurdity of the West is the living reality of the East“.9
Betrachtet man eine verfassungspolitische Entwicklung im postsowjetischen Raum der vergangenen dreißig Jahre, so stellt man fest, dass die verfassungsideologische Expansionspolitik des Westens einen grandiosen Schiffbruch erlitten hat und auf der ganzen Linie gescheitert ist. Die verfassungspolitische Offensive des Westens unter dem inhaltsleeren Schlagwort „Demokratieförderung“ musste allein schon deswegen ins Leere laufen, weil das erwachte Nationalbewusstsein der zahlreichen Völker im postsowjetischen Raum von deterministischer und nicht voluntaristischer Natur war, von der fehlenden neuzeitlichen Rechts- und Verfassungstradition ganz zu schweigen. Die verfassungsideologische Offensive des Westens hinterließ nur eine ideologische Schneise der Verwüstung in dem tradierten Leben dieser Völker und konnte keine liberale, verfassungspolitische Erneuerung in Gang setzen.
Der Übergang zu einem liberalen Verfassungsstaat ist aber „gerade dadurch bestimmt, dass das Territorialprinzip im Ganzen durch das des Personenverbandes ersetzt wird“ und dass dieser „Austausch von Prinzipien den modernen Staat (erst) konstituiert.“10 Ein liberaler Verfassungsstaat ist nämlich nicht „eine Habe“ (Kant), ein Territorium, auf dem Menschen „als bloße Anhängsel des Bodens zu behandeln (sind), die mit diesem erworben oder veräußert werden können“ (ebd., 379).
Ein moderner Staat ist ein Verbund von Menschen, dessen Entscheidungsprozesse sich in einem institutionalisierten Verfahren äußern, welche die Bürger erst dann als legitim erachten, wenn sie zuvor als Mitentscheider des institutionalisierten Verfahrens auftreten können. Der Wandel vom totalitären Einheitsstaat zu einem liberal-demokratisch verfassten Nationalstaat schlug im postsowjetischen Raum allein schon deswegen fehl, weil die abgespalteten Sowjetrepubliken sich primär als Territorial- und nicht als Personenverbände konstituierten.
Das Kernproblem der vom Sowjetimperium abgespaltenen Territorien, die sich als „souverän“ verklären, ohne souverän zu sein, ist, dass diese neu entstandenen Machtgebilde nach wie vor den Traditionsbeständen wie Abstammung, Schicksalsgemeinschaft oder archaischen Machtstrukturen verhaftet sind und darum per definitionem zu einer Entgrenzung ihres nationalstaatlichen Identitätsbewusstseins weder fähig noch willig sind. Der westlichen Verfassungsideologie mit ihrer„Entsubstanzialisierung des neuen nationalstaatlichen Identifikationsangebots“ (ebd., 379) steht eben diese traditionsbedingte und ethnisch gefärbte Entgrenzungsunwilligkeit des postsowjetischen, nationalen Identitätsbewusstseins entgegen. Sie kann es darum weder überwinden noch brechen.
Indem alle tradierten Inhalte einer verfassungspolitischen Integration des vormodernen Europas durch das neuzeitliche Legitimationsprinzip aufgerieben wurden und an ihre Stelle Verfahren traten, in denen über Inhalte unter Beteiligung der Staatsbürger erst entschieden wird, bezeichneten die nationalstaatlichen Grenzen nichts anderes als die Geltungsgrenzen dieses neuen Legitimationsprinzips und der auf dessen Grundlage zustande gekommenen Verfassungsordnung. „Grenzen dieser Art sind aber von vornherein auf Grenzüberschreitungen hin angelegt“ (ebd., 379).
Der immer wieder stattfindende Versuch einer Sprengung der nationalen und kulturellen Identitätsgrenzen des postsowjetischen Raumes mittels des grenzüberschreitenden Legitimationsprinzips der Neuzeit ist deswegen nichts anderes als eine andere Art des verfassungspolitisch fundierten, westlichen Expansionismus zwecks Oktroyierung der universalideologisch festgelegten Welt- und Wertordnungsentwürfe, um anschließend den eigenen, geopolitischen und geoökonomischen Machtwillen einfacher durchsetzen zu können.
Da aber das postsowjetische Identitätsbewusstsein raumgebunden, nicht entgrenzend und darum gegenüber dem Entgrenzungszwang der westlichen Verfassungsideologie immun ist, kann sich die verfassungspolitische Expansion des Westens gen Osten einen Erfolg nur mit Gewalt verschaffen. Würde eine solche verfassungspolitisch „erfolgreiche“ Eroberung des postsowjetischen Raumes gelingen, dann würde nicht so sehr ein Rechts- und Verfassungsstaat etabliert, als vielmehr dessen Fassade, was wir im Übrigen heutzutage am Beispiel der Ukraine nach 2014 beobachten dürfen. Diese (ukrainische) Fassade wurde zu einer jeglicher liberalen Verfassungssubstanz entleerten Machtkonstruktion, welche die oktroyierten Verfassungsvorstellungen nach außen bloß imitiert, nach innen aber weder in der Lage noch gewillt ist, ihnen Folge zu leisten. Diese bloße Imitation geht zum einen mit Verlust der eigenen kulturellen Identität einher, ohne dass sich die oktroyierten Verfassungsvorgaben etablieren (können), und wirkt sich zum anderen destruktiv auf die traditionellen Lebensstrukturen aus, nachdem sie die eigene historisch-gewachsene Tradition für disponibel erklärt hat.
Die historisch-gewachsenen Macht- und sozialen Strukturen lassen sich im Sinne der westlichen Verfassungsideologie von außen weder transformieren noch reformieren, sondern nur manipulieren, da diese kraft ihrer Eigengesetzlichkeit bestehen können und genügend Abwehrkräfte besitzen, um dem Widerstand leisten zu können. Weil aber das postsowjetische Identitätsbewusstsein raumgebunden und darum von defensiver Natur ist, kann es zwar die verfassungspolitische Expansion des Westens abwehren, aber keinen verfassungspolitischen Gegenentwurf zur westlichen Verfassungsideologie anbieten und bleibt darum außerhalb des eigenen Kulturraumes kraft- und wirkungslos.
2. Menschenrechtsideologie im Lichte der US-Innenpolitik
Die aus den rechts- und verfassungshistorischen Entwicklungen Europas hervorgegangene Tradition der Grund- und Menschenrechte wird längst als Vehikel im Kampf gegen die geopolitischen Rivalen Russland und China instrumentalisiert.
Grund- und Menschenrechte konstituieren ein bestimmtes, rechtlich verbindliches Verhältnis zwischen Staat und Individuum dergestalt, dass sie die Rolle des Staates und dessen Grenzen definieren, indem sie das staatliche Gewaltmonopol bzw. die staatliche Gewaltanwendung dem Individuum gegenüber einschränken und begrenzen. Menschenrechte werden zwar von naturrechtlichen Theorien aller Art entwickelt; sie sind aber vor allem ein zivilisatorisches Ergebnis der spezifisch europäischen Rechts- und Verfassungsentwicklung bzw. ein Ausdruck der historisch- gewachsenen, europäischen Lebenskultur und dürfen darum nicht mit der amerikanischen bzw. westlichen Menschenrechtspolitik der Nachkriegszeit verwechselt werden.
Die amerikanische Menschenrechtspolitik feierte ihre Entstehung mit der Verankerung der Menschenrechte in der UN-Charta sowie in der „Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte“ vom 10. Dezember 1948. Zwanzig Jahre lang passierte zunächst so gut wie nichts.
„Erst zu Beginn der siebziger Jahre wurde dann das Instrument Menschenrechte in einer sehr komplexen Weise Teil der amerikanischen Politik“.11 Die Ironie der Geschichte lag darin, dass sie von Akteuren des Kongresses ausging, der über zwanzig Jahre eine aktive Menschenrechtspolitik verhindert hat, wohingegen die Nixon/Ford-Administration zwischen 1972 und 1976 zäh gegen diese Kongresspolitik ankämpfte. Die Menschenrechtspolitik war in der erwähnten Zeitperiode noch keine„weltmissionarische Außenpolitik“; vielmehr diente sie nach 1972 einem Teil des Kongresses im Wesentlichen als innenpolitisches Instrument im Kampf gegen die von Nixon/Kissinger eingeleitete Entspannungspolitik. Sie diente wiederum einem anderen Teil des Kongresses nach dem Chile-Debakel von 1973 (dem Sturz von Allende durch das Militär) dazu, „die Lateinamerikapolitik von einer prinzipiell >wertneutralen< Politik hin zu einer Politik, die auf mehr Rechtsstaatlichkeit in den Diktaturen bzw. auf deren potenzielle Demokratisierung hinarbeitet, umzuorientieren“ (ebd., 70 f.).
Die Menschenrechtspolitik trug somit von Anfang an einen innenpolitisch motivierten instrumentellen Charakter, mal mit „weltmissionarischen“, mal mit sicherheits- bzw. geopolitischen Argumenten ausgetragen. Und die Europäer? Sie nahmen zunächst von den innenpolitischen Menschenrechtsdiskursen in den USA kaum eine Notiz. Erst als der amerikanische Chefdelegierte Arthur Goldberg bei der Belgrader Nachfolgekonferenz zur Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1977/78 Verhandlungen mit einer für die europäische Entspannungspolitik ungewöhnlichen, ideologischen Härte in Menschenrechtsfragen führte,12 wurden die Europäer auf die ideologische Linie gebracht.
Das war die Geburtsstunde der Menschenrechtsideologie. Sie ist das Relikt des Kalten Krieges und in diesem menschenrechtsideologischen Sinne hat der Kalte Krieg bis heute nicht aufgehört zu existieren. Mit Carters Präsidentschaft und erst recht seit Ronald Reagan wurde die Menschenrechtsideologie nicht nur „als Instrument einer Weltordnungspolitik“, sondern auch „gezielt und nahezu … ausschließlich im Rahmen der Systemauseinandersetzung“ eingesetzt (ebd., 72).
Die US-amerikanische außenpolitische Elite teilte nunmehr die Staatenwelt in drei Kategorien: „demokratische (gute), autoritäre (problematische) und totalitär-kommunistische (schlechte) Staaten“. Ging Carters Außenpolitik von der Hilfskonstruktion aus, „die autoritären und totalitären Staaten in Koinzidenz zu bringen“, so kehrte die Reagan-Administration „zu Sichtweise der Eisenhower- Administration zurück“ (ebd., 87 f.) und betonte den Unterschied zwischen autoritären und totalitären Regimen.
Nun empfahl der hier oft zitierte Jakob Schüssler (ebd., 88) im Jahr 1982, die alte Trennung zwischen totalitären und autoritären Systemen einzuführen. Der Vorteil einer solchen Unterscheidung wurde damit begründet, dass dann der Begriff autoritär als Bezeichnung für „befreundete Diktatoren“ aufgewertet wird, worunter natürlich die mit dem Westen zur Zeit des Kalten Krieges befreundeten autoritären Regime wie Spanien, Portugal, die Philippinen, Schah-Iran, die griechischen Obristen oder türkischen Generäle gemeint waren. Die Menschenrechtspolitik der Reagan-Administration sollte also die autoritären Staaten nicht mit Hilfe des Menschenrechtsstandards delegitimieren, sondern der Maßstab sollte einzig und allein den totalitären Staaten gelten.
Auch hier wird der instrumentelle Charakter der Menschenrechtspolitik mehr als deutlich. In Unkenntnis dieser längst vergessenen ideologischen Gefechte des Kalten Krieges sucht man neuerdings die aktuellen geopolitischen Herausforderungen ideologisch zu verkleistern. In heller Begeisterung vom „glorreichen“ Sieg Joe Bidens über den „in Europa viel Vertrauen“ zerstörenden „Wahlverlierer“ Donald Trump berichtet der Korrespondent des Handelsblatts Moritz Koch am 10. November 2020 (S. 16) unter dem vielsagenden Titel „Allianz der Demokratien“ über Bidens Essay für das Fachmagazin „Foreign Affairs“ aus dem Frühjahr d. J.: „Der Triumph von Demokratie und Liberalismus über Faschismus und Autokratie schuf die freie Welt“, schreibt Biden. „Aber dieser Wettstreit definiert nicht nur unsere Vergangenheit“, prophezeit Biden. „Er wird auch unsere Zukunft bestimmen.“ Wenn Biden Faschismus und Autokratie in einem Atemzug nennt, so ist das nicht nur ahistorisch, sondern auch eine Verharmlosung des Faschismus.
Mit voller Zustimmung zu Bidens Äußerungen meint nun Koch: „Biden beschreibt einen neuen Systemkonflikt, einen Machtkampf zwischen der freien Welt und ihren autoritären Herausforderern“. „Ein neuer Systemkonflikt“? „Ein Machtkampf“ zwischen Freiheit und Knechtschaft? Ist man noch bereit, die Äußerungen des alten Haudegens des Kalten Krieges Joe Biden als Reminiszenzen der längst vergangenen Epoche und der Wahlkampfrhetorik geschuldet abzutun, so wundert man sich schonüber die jüngere Generation, die über „autoritäre Herausforderer“ schwadroniert, die angeblich unsere „freie Welt“ bedrohen, und in Unkenntnis der Geschichte von „befreundeten“, „autoritären Staaten“ daraus einen neuen Kalten Krieg herausphantasiert. Vielleicht sollte sich der junge Kalte Krieger auf die Suche nach einer neuen Terminologie begeben, bevor er einen „neuen“ Kalten Krieg propagiert.
Wie auch immer, die menschenrechtsideologische Auseinandersetzung setzt sich heute mit zwei US- Gesetzen (dem sog. „Magnitsky Act“ (2012) und dem „Global Magnitsky Act“ (2016)) und neuerdings mit einer EU-Variante des „Magnitsky Act“ („European Magnitsky Act“ aus dem Jahr 2020) unvermindert fort. Sie wird mit dem geopolitischen Rivalen Russland solange fortgesetzt, solange die USA der Welthegemon bleiben und solange das überlieferte Denken des Kalten Krieges von Generation zu Generation kritiklos weitergereicht und -gelebt wird. Es geht aber hier gar nicht um einen „neuen Systemkonflikt“, sondern allein um eine geopolitische und geoökonomische Konfrontation mit dem Ziel, Russland entweder mittels menschenrechtsideologischer Interventionen und Einmischungen in den Innenraum der Macht „umzuerziehen“ oder einen Zerfallsprozess der russischen Staatlichkeit herbeizuführen.
Im Glauben, damit einen vergleichbaren Erfolg wie zur Zeit des Kalten Krieges erzielen zu können, übersehen die westlichen Geostrategen, dass die Zeiten sich geändert haben, und überschätzen dadurch die eigene ideologische Anziehungskraft bei einer gleichzeitigen Unterschätzung des stattfindenden Erosionsprozesses der US-Welthegemonie.
Die geopolitisch instrumentalisierten >Menschenrechte< haben mit den aus der „Natur des Menschen“ abgeleiteten „unveräußerlichen“, „unabdingbaren“ und „angeborenen“ Rechten des Menschen und darauf gegründeten individuellen, subjektiven Rechtsansprüchen nur dem Namen nach etwas zu tun. Die Menschenrechtspolitik verliert ihre „axiomatischen Wahrheiten“ und wird zur Menschenrechtsideologie in dem Augenblick, indem sie nicht mehr auf die Rechtsansprüche des Individuums zurückgeführt, sondern von der innen-, außen- und geopolitischen Opportunität abgeleitet und zu „objektiven Systemzwecken“ umfunktioniert wird. Wenn die Menschenrechtideologie aber von geopolitischen Präferenzen statt von der „Natur des Menschen“ abgeleitet wird, entkoppelt sie die Menschenrechte von ihrem natur- und subjektivrechtlichen Kontext und transformiert „ursprünglich vorstaatliche Rechte der Abwehr gegen das staatliche Gewaltmonopol in Aufgabenkataloge für ein globales Gewaltmonopol“ des Westens dergestalt, dass sie die „Freiheitsrechte zu Ermächtigungsnormen umdefiniert“ und so „die gesamte Weltbevölkerung zum bloßen >Material< der Menschenrechtsverwirklichung“ verwertet.13
Was es mit der geopolitischen Opportunität als Quelle der „Ermächtigungsnormen“ zur Durchsetzung der Menschenrechte auf sich hat, wissen wir heute viel besser als zur Zeit des Kalten Krieges. Wir beobachten zum einen innenpolitisch vor dem Hintergrund der digitalen und technologischen Revolution des 21. Jahrhunderts u. a. den zunehmenden Einfluss der Geheimdienste und der Geheimpolitik auf Innen- und Außenpolitik. Es besteht offenkundig eine Diskrepanz zwischen öffentlicher Rhetorik und praktizierter Politik, Worten und Taten, öffentlichen Ankündigungen und verborgenen Handlungen. Es ist darum der Feststellung von Andreas Bracher kaum zu widersprechen, die da lautet: „Geheimdienste sind jene Organisationen, die dem Staat im Geheimen die Willkürbefugnisse wieder zurückgeben, die ihm – unter anderen durch die Menschenrechte – offiziell genommen worden waren. Da die Staaten sich heute gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet fühlen, die Menschenrechte hochzuhalten, begehen sie ihre Menschenrechtsverletzungen im Geheimen, eben durch Geheimdienste“.14
Die historisch-gewachsenen Lebens- und Machtstrukturen der außerwestlichen Kultur- und Machträume werden zum anderen außenpolitisch mittels der sog. „farbigen Revolutionen“, „humanitären Interventionen“ und zahlreichen US-Invasionen regelrecht plattgewalzt, ohne dass sich die betroffenen Länder und Menschen über Demokratie und Menschenrechte erfreuen können. Es herrscht stattdessen überall Verelendung der Massen, Zerstörung und Verwüstung von Grund und Boden.
Die westliche „heilbringende“ Frohbotschaft von Demokratie und Menschenrechten entpuppt sich dann für die „unzivilisierten“ Völker eher als Fluch, denn als Segen, und die Anti-Moderne triumphiert erneut mit einem monströsen Verlust an Menschenleben. Mit der Verhöhnung der anderen Kulturen im Namen der Menschenrechte feiert die Anti-Moderne die Rückkehr und Wiederkehr des „europäischen Jahrhunderts“ mit seiner „Herrschaft über Untertanenrassen“ (Lord Cromer)15.
Die Loslösung der Menschenrechtsideologie von der Geschichte und ihre Bindung an die geopolitische Opportunität bestätigen zudem nur Edmund Burkes Argumentation, die er „der Erklärung der Menschenrechte durch die Französische Revolution entgegengehalten hat“, dass nämlich die „Menschenrechte nichts sind als eine sinnlose >Abstraktion<“. Es sei „politisch sinnlos …, seine eigenen Rechte als unveräußerliche Menschenrechte zu reklamieren, da sie konkret niemals etwas anderes sein können als die Rechte eines Engländers oder eines Deutschen … Die einzige Rechtsquelle, die bleibt, … scheint in der Tat die Nation zu sein; >aus der Nation< also, und nirgendwo sonst entspringen die Rechte, sicher nicht aus Robespierres >Menschheit, dem Souverän der Erde<“16 und schon gar nicht aus den Hauptstädten der sogenannten „Freien Welt“.
Abstrakte Leitbegriffe der Universalideologie wie Demokratie und Menschenrechte sind, da sie in einer konkreten, rechtshistorischen und verfassungspolitischen Entwicklung ihre spezifische Bedeutung erhielten und darum eine spezifisch westliche Lebensrealität reflektieren, kaum geeignet, ihre Authentizität den anderen, historisch-gewachsenen Kultur- und Machträumen zu oktroyieren, welche die Willensbildungsprozesse hochkomplexer, politischer und gesellschaftlicher Institutionen auf traditionell andere Art und Weise sanktionieren und nicht nur die Mentalität einer Vielzahl von Individuen als solchen, sondern auch zahlreiche, traditionsgebundene Lebensstrukturen, Organisationen und Suborganisationen präformieren. Sie können von außen unmöglich umprogrammiert werden.
Die amerikanische Hegemonialstellung hat den US-Hegemon offenbar vergessen lassen, dass er vielleicht (noch) der Herr der Welt, aber nicht deren Schöpfer ist.
1. Die westliche universale Idee im Lichte der säkularisierten Eschatologie
Der westliche Universalismus wünscht sich den globalen Raum „human“ domestizieren zu können, indem er seine „Humanität“ dergestalt auf die Hegemonie gründet, dass dieser selbst „anerkennen“ sollte, dass der „gütige“ Hegemon allein zum Wohle der Menschheit handele. Wird der westliche Universalismus außenpolitisch aktiv, folg er unvermeidlich der geopolitischen Logik. Diese entwickelt sich aus den Denkmustern, die zwar ihrem eigenen kulturellen Umfeld entnommen werden, die aber nicht ohne weiters auf die wertfremden Kultur- und Machträume übertragbar sind. Es ist eine gefährliche Illusion zu glauben, der westliche Universalismus könne sich – losgelöst von seiner eigenen kulturellen Umwelt und außerhalbseines Kulturkreises – erfolgreich etablieren bzw. gedeihen.
Glaubte die antike Welt, „dass kommende Ereignisse durch eine bestimmte Kunst der Weissagung entschleiert werden können“, und verlor dieses Vertrauen auf Weissagung an Ansehen erst, als die Kirche es untergrab, so glaubt der aufgeklärte Westen heute erst einmal an gar nichts. Er bildet sich vielmehr ein, „die Zukunft könne sich durch ihn selbst geschaffen werden. Er hält sie für unerkundbar, weil er sie selbst herbeiführen will“17 und damit ungewollt und unbewusst eine Art säkularisierter Eschatologie praktiziert, in deren Zentrum nicht mehr der Schöpfungsgott, sondern das Geschöpf Gottes mit seinen selbstproklamierten „universalen“ Werten steht.
So hat der prognostizierte Vormarsch von Demokratie und Menschenrechten beinahe „den Charakter von einem unausweichlichen Fatum wie von einer göttlichen Vorsehung. Sowohl wer ihn fördert wie wer ihm widerstrebt, ist ein blindes Werkzeug in der Hand einer Macht, die die Geschicke lenkt“. Diese „unvermeidliche“ Entwicklung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat sei „eine providentielle Tatsache und sie besitzt alle Merkmale eines göttlichen Ratschlusses: sie ist universal … alle Ereignisse und Menschen dienen ihrem Fortschritt“. Der Versuch, die Demokratie auszubremsen, würde bedeuten, gegen die Vorsehung und „gegen Gott selbst zu kämpfen. Die Unmöglichkeit, diesen Vormarsch aufzuhalten, „ermöglicht andererseits die Voraussagbarkeit ihrer künftigen Entwicklungen“18.
Nur innerhalb dieser säkularisierten Eschatologie werden die westlichen Werte „universal“. Die „Universalität“ ist allerdings hier eines menschlichen und nicht göttlichen Ursprungs; sie geht nunmehr aus dem „Geschöpf Gottes“ – der westlichen Zivilisation – hervor, das die Geschicke des globalen Raumes vorauszubestimmen und herbeizuführen glaubt, weil es sich „allein“ im Besitz des „teleologischen Universalismus“19 sieht. Die säkularisierte Eschatologie hat längst das historischeChristentum hinter sich gelassen und ist längst zum Christentum zurückgekehrt, in dem „die Geschichte von der Eschatologie verschlungen worden“ ist. Die urchristliche Gemeinde verstand sich eben „nicht als geschichtliches, sondern als eschatologisches Phänomen“20.
Nach dem „Ende der Geschichte“ versteht sich die westliche Zivilisation heute ebenfalls als „eschatologisches Phänomen“. Sie gehört anscheinend nicht mehr zu unserer diesseitigen, geschichtlichen Welt, sondern befindet sich längst in einem jenseitigen, geschichtslosen Äon, wohin der Weg auch für den globalen Raum vorgezeichnet sein soll und wohin >der russische Weg< gar nicht zu gelangen braucht. Denn die russische Rechtsgläubigkeit befand sich stets – sozusagen eingefroren – in einem urchristlichen Zustand als einem geschichtslosen Äon, in dem sie – asketisch und der Welt entrückt – immer schon da gewesen war und sich mit Blick auf die Jenseitigkeit der menschlichen Existenz als eine eschatologische Religion des Leidens und des Verzichts verstand.
Das historische Christentum des Westens ist demgegenüber ein Widerspruch in sich, „weil der böse Genius des modernen Lebens, sein >Erwerbsinn< und sein >Machtsinn<, dem freiwilligen Leiden und der Selbstverleugnung entgegengesetzt sind“21. Die säkularisierte Eschatologie des westlichen Universalismus ist ihrer Intention nach ambivalent: Sie soll im Westen schon erfüllt, aber im globalen Raum noch nicht vollendet sein. Die Zeit zwischen Erfüllung und Vollendung ist determiniert; aber sie ist, solange sie da ist, eine Zwischenzeit eben nach der Erfüllung und vor der Villendung des verkündeten „Reiches“ des nicht mehr nur westlichen, sondern auch globalen Universalismus. Infolge dieses Zwischenzustandes, in dem alles schon (teilweise) ist, aber eben noch nicht (global) da ist, lebt der gläubige Universalist nicht nur in einer hoffnungsvollen Erwartung der kommenden globalen Herrschaft der westlichen Werte, sondern er unterstützt – einmal an die Macht gelangt – diese auch machtvoll mit allen ihm zur Verfügung stehenden, einschließlich bellizistischen Machtmitteln.
Dieses am „Ende der Geschichte“ angekommene Geschichtsverständnis ignoriert allerdings die kulturelle Pluralität der historischen Erfahrungen im globalen Raum. Die zahlreichen Umwälzungen und Transformationsprozesse der jüngsten Vergangenheit lassen nämlich die abstrakten Prämissen der säkularisierten Eschatologie links liegen. Die Überhöhung des Vorbildcharakters der eigenen wertlogischen Prämissen birgt in sich nicht nur eine gefährliche, weil friedensgefährdende Ignoranz der anderen Kulturen, sondern verkennt auch die Einmaligkeit und Einzigartigkeit der eigenen geistes- und verfassungsgeschichtlichen Entwicklungen.
Die abendländische Geistesgeschichte verdankt ihren Ursprung einer merkwürdigen, ja eigenartigen geistigen Synthese des antiken Erbes mit der heilsgeschichtlichen Botschaft der übernatürlichen Theologie. Die Synthese hat die westliche Welt in den Strudel des historischen Christentums hineingezogen, dessen transzendenter Offenbarungsglaube zum einen rationalisiert und verweltlicht und dessen profane Kultur zum anderen derart entchristianisiert wurde, dass es sich dem antiken Glauben freiwillig ergeben und unbewusst zu dem Ursprung der griechischen Antike zurückgekehrt ist, die der Polis „den Charakter der Heiligkeit“22 zusprach. Die Antike war und ist bis heute „alt, aber (eben) nicht veraltet“. Sie hat ein völlig anderes Geschichtsverständnis, dessen Gesetz „nicht der Fortschritt, sondern … die Entfaltung aus dem Ursprung und der Rückkehr in den Ursprung“23 ist.
Weder das Christentum noch die antike Welt glaubten allerdings an den Fortschritt so, wie wir es heute glauben. Glaubten die Griechen an die ewige und unvergängliche Physis des Kosmos und denaturiert die Offenbarungstheologie die Physis und den Kosmos, indem sie diese als aus sich bestehend negiert und vom Schöpfungsgott aus dem Nichts erschaffen lässt, so glaubt der vom Fortschrittsglauben inspirierte westliche Universalismus, seine universalen Werte ebenfalls aus dem Nichts schaffen zu können, indem er sich selbst enthistorisiert, sein historisch gewachsenes Selbstverständnis universalisiert, die wertfremden Machträume delegitimiert, um anschließend seine Wertlogik kraft der eigenen „Wertvollkommenheit“ zu oktroyieren.
Die westliche universale Idee erweist sich als ein säkularisierter Schöpfungsglaube, dessen Demiurg der Westen selbst ist, der seine Werte dergestalt aus dem Nichts schaffen lässt, dass die wertfremden Machträume infolge ihres „Vergänglichkeitscharakters“ an sich selbst zugrunde gehen, von selbst wertlos werden und sich anschließend der „unvergänglichen“, „ewigen“ westlichen Werttransfusion unterziehen lassen. Diese kulturellen Grenzen und unterschiedliche historische Erfahrungen ignorierende und alle völkerrechtlichen Grenzen sprengende, säkularisierte Eschatologie macht das Selbstverständlichste zum Allerfragwürdigsten, indem sie historisch gewachsenen, faktisch existierenden Wertpluralismus negiert.
Weder die Antike Welt noch die christliche Theologie haben die Welt so begriffen, wie die „aufgeklärte“ Moderne. Verändert hat sich allerdings zunächst nur „das Weltbild von der Welt. Aber verbürgt uns, dass das moderne Weltbild der mathematischen Physik die physis angemessener versteht, als die Physik etwa des Aristoteles … Es gibt zwar eine moderne Naturwissenschaft, aber keine moderne Natur.“24
Und wer verbürgt uns, dass sich die Ordnung des globalen Raumes nach der Wertlogik des westlichen Universalismus „besser“, d. h. friedfertiger gestalten lässt, als die Weltordnung des hier und heute existierenden Wertpluralismus?
Anmerkungen
1. Zitiert nach Hans Rothfels, Sinn und Grenzen des Primats der Außenpolitik, in: ders., Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Vorträge und Aufsätze. Göttingen 21959, 167-178 (167).
2. Canis, Von Bismarck zur Weltpolitik (wie Anm. 26).
3. Rothfels (wie Anm. 1), 169.
4. Zitiert nach Bernd Faulenbach, Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München 1980, 182.
5. Wehler, H.-U., Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen. München 52019, 100.
6. Ebd., 107.
7. Conze, W., Nationalstaat oder Mitteleuropa? Die Deutschen des Reiches und die Nationalitätenfragen Ostmitteleuropas im Ersten Weltkrieg, in: Deutschland und Europa: Historische Studien zur Völker- und Staatenordnung des Abendlandes. Düsseldorf 1951, 201-230 (202).
8. Winkler, Der Nationalismus und seine Funktion, in: ders., Liberalismus und Antiliberalismus. Studien zur politischen Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Göttingen 1979, 52-80 (52 f.).
9. Zitiert nach Hans Rothfels, Grundsätzliches zum Problem der Nationalität, in: ders., Zeitgeschichtliche Betrachtungen (wie Anm. 1), 89-111 (98).
10. Maus, I., Vom Nationalstaat zum Globalstaat oder der Verlust der Demokratie, in: ders., Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie. Berlin 2011, 375-406 (378).
11. Schüssler, J., Zwischen Weltordnungspolitik und Antikommunismus, in: Amerikanische Außenpolitik im Wandel, hrsg. v. Ernst-Otto Czempiel. Stuttgart 1982, 69-92 (70).
12. Vgl. Schüssler (wie Anm. 11), 71.
13. Maus, I., Der zerstörerische Zusammenhang von Freiheitsrechten und Volkssouveränität in der aktuellen nationalstaatlichen und internationalen Politik (1999), in: ders., Über Volkssouveränität (wie Anm. 10), 359-374 (361 f., 374).
14. Bracher, A., Menschenrechte und ihre Propagierung, in: ders., Europa im amerikanischen Weltsystem. Bruchstücke zu einer ungeschriebenen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Basel 2001, 131-140 (136 f.).
15. Zitiert nach Arendt, H., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Bd. II: Imperialismus. Frankfurt/Berlin/Wien 1975,7.
16. Zitiert nach Arendt, H., Elemente totaler Herrschaft. Frankreich 1958, 47 f. 17. Löwith, K., Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Tübingen 1983, 20 f.
18. Ebd., 21.
19. Ebd., 29.
20. Bultmann, R., Geschichte und Eschatologie. Tübingen 1958, 42.
21. Löwith (wie Anm. 17), 41.
22. Bultmann, R., Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen. Zürich und München 51986, 117.
23. Friedrich, H., Abendländischer Humanismus, in: Europa als Idee und Wirklichkeit. Freiburg 1955, 3-47 (46).
24. Löwith, K., Wissen, Glaube und Skepsis. Stuttgart 1985, 262 f.